zum Inhaltsverzeichnis

zu den anderen Stories

Story #3
Überforderte*r
Workaholic
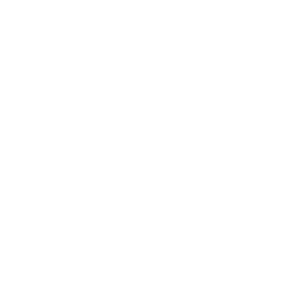
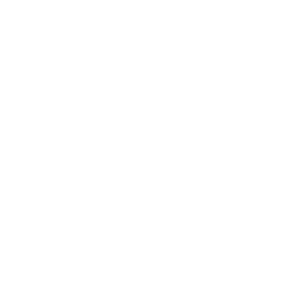
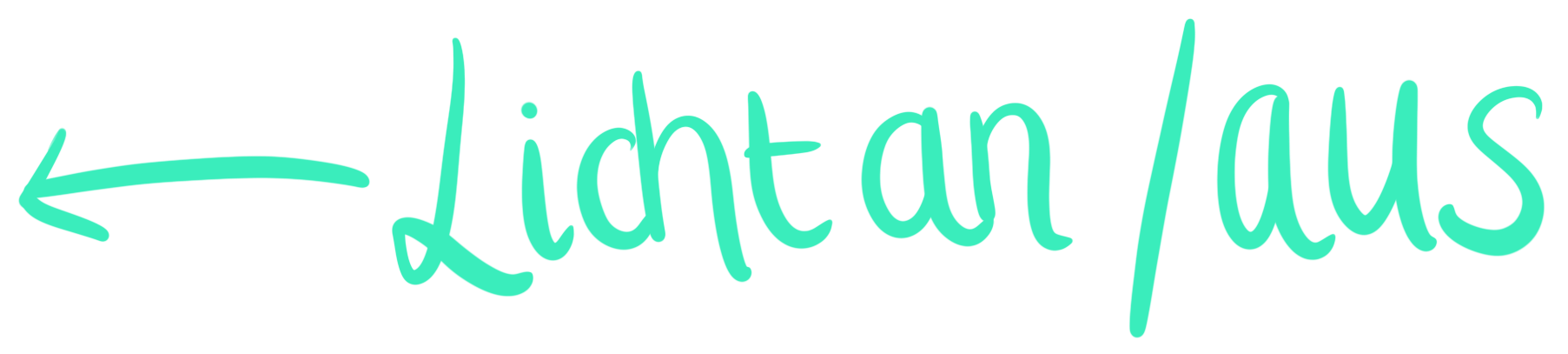
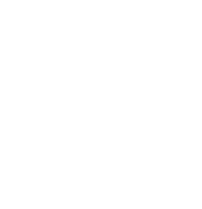
scroll nach unten
Inhalte:
1. Was ist passiert?
2. Definition
3. Arten
4. Bereiche
5. Ursachen
6. Wie geht es weiter?
7. Konsequenzen
8. Strategien

Schau dir die Storyinhalte:
(1. Was ist passiert & 6. Wie geht es weiter) hier an.
Willst du aber in die Wissenseinheiten:
(2.-5. und 7.-8.) eintauchen, wechsle auf ein größeres Display.
1. Was ist passiert?
Geschichte anhören:
Geschichte lesen:
Du sitzt gestresst im Auto. Der zeitliche Druck, pünktlich zur Arbeit zu kommen, und die drei nach dem Aufstehen inhalierten Kaffees - weil du das ganze Wochenende von zu Hause aus durchgearbeitet hast, statt mit deiner Familie in die Berge zu fahren - schaukeln deine Anspannung gegenseitig hoch.
Mit ständig wechselndem Blick zwischen der Uhrzeit und der Straße bahnst du dich langsam durch den Straßenverkehr. Wie jeden Tag bist du mit einer Stunde Puffer von zu Hause losgefahren. Bei dieser zeitlichen Planung bist du zwar immer mindestens eine halbe Stunde zu früh im Büro, aber sicher ist sicher.
Heute sieht es jedoch anders aus: du steckst noch mitten auf dem Arbeitsweg fest, zu einer Zeit, zu der du normalerweise schon längst geparkt hast.
Als sich die Autos vor dir nach einer gefühlten Ewigkeit in Gang setzen, gehst du erleichtert aufs Gas. „Endlich!“ denkst du dir, und versuchst bewusst, nicht schon wieder auf die Uhr zu schauen - vergeblich.
Du richtest den Blick kurz darauf wieder auf die Straße, und reißt erschrocken das Lenkrad herum - weil du die rote Ampel übersehen hast, hättest du beinahe eine alte Frau angefahren.
Dein Herz schlägt rasend schnell, und beruhigt sich erst wieder, als du um die Ecke biegst und siehst, dass wenigstens dein Parkplatz heute nicht unrechtmäßig von jemandem besetzt ist.
Den vorhergegangenen Schock schon wieder verdrängt, stellst du hastig den Wagen ab. „Ich kann es noch bis Punkt acht Uhr schaffen. Ich muss es schaffen!“ sagst du dir bei einem letztem Blick auf die Uhr, und beginnst zu rennen.
Außer Atem im Aufzug angekommen, drückst du 30x Mal auf den Knopf zu deinem Stockwerk. „Fast geschafft“ freust dich - aber nur kurz, denn in diesem Moment wechselt der Zeiger deiner Armbanduhr von 8:00 zu 8:01 - und erst in dieser Minute öffnet sich die Fahrstuhltür zu deinem Büro.
„Eine Minute ist auch schon zu spät.“ hat deine Lieblingslehrerin stets gepredigt. Sie saß bereits im Klassenzimmer, als die ersten Kinder in der Früh einen Fuß in die Schule setzten. Du wolltest seit du denken kannst so sein wie sie und bist dem eigentlich auch schon sehr nahe gekommen - bis jetzt.
Denn gerade bist zum ersten Mal in deinem Leben unpünktlich.
Was ist Perfektionismus?
2. Definition

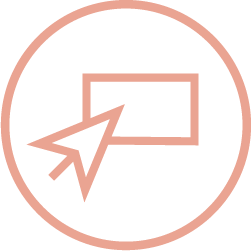
Wähle die Definition aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.
Liegst du falsch, versuche es erneut.
Eine psychische Krankheit, bei der sich Betroffene durch das exzessive Streben nach Perfektion selbst kaputt machen.
Ein ein- und ausschaltbares Phänomen, mittels dessen Perfektion problemlos erreicht werden kann.
Eine persönliche Eigenschaft, gekennzeichnet durch die Anschauung, dass das Perfekte besteht und das angestrebte Ideal darstellt.
Perfektionismus ist eine persönliche Eigenschaft, gekennzeichnet durch die
Anschauung, dass das Perfekte besteht und das angestrebte Ideal darstellt.
Er ist weder eine mentale Krankheit, noch eine rein positive Garantie für Perfektion -
genauso wenig, wie er sich an- und abstellen lässt.
i
Generell ist wichtig zu wissen, dass rund um das Thema diverse wissenschaftliche Ansichten existieren. Zur Vereinfachung wird hier der mehrheitliche Konsens abgebildet.
Er ist ein sehr verbreitetes Phänomen, da etwa zwei Drittel der deutschen
Bevölkerung zum Perfektionismus neigen.
Du bist dir unsicher, ob du selbst perfektionistisch bist oder nicht? Dann mache einen
der verbreitetsten fundierten Tests, um diese Frage zu beantworten:
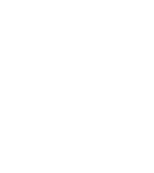
Frost Multidimensional Perfectionism Scale-Deutsch
Welche Art von Perfektionismus ist in dieser Story vertreten?
3. Arten

3. Arten

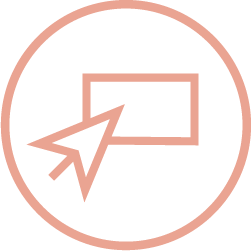
Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.
Liegst du falsch, versuche es erneut.
funktionaler
dysfunktionaler
keiner
Die vertretenen perfektionistischen Eigenschaften lassen sich auf der dysfunktionalen Seite verordnen. Wo Perfektionismus in seiner Gewichtung grundlegend neutral ist, bestimmt das Zusammenspiel der Eigenschaften (siehe pinker und blauer Kreis) innerhalb der Perfektionismus Bandbreite, ob das Phänomen mehr in die eine (perfektionistisches Streben) oder andere (perfektionistische Sorgen) Richtung ausfällt. Analog dazu ergibt sich die eine (funktionale) oder andere (dysfunktionale) Art.
i
Für die Differenzierung in eine negative und eine positive Variante des Perfektionismus gibt es diverse Bezeichnungen. Aus Gründen der Einfachheit wird sich hier stets auf den funktionalen und dysfunktionalen Perfektionismus berufen.
* In dieser Story nicht vertreten


Grafik in Anlehnung an Lo, Alice; Abbott, Maree J.: Review of the Theoretical, Empirical, and Clinical Status of Adaptive and Maladaptive Perfectionism; Behaviour Change, 30, S. 96-116, 2013 (S. 98/99); adaptiert aus Stoeber, Joachim; Otto, Kathleen: Personality and Social Psychology Review, 10, 295-319, Figure 1, 2006
Aus den Eigenschaften lassen sich außerdem drei Kernmerkmale für den
dysfunktionalen Perfektionismus aufstellen:
1. Das Ausmaß der Anforderungen (Teil der Dimension „persönliche Maßstäbe“)
2. Die Statik der Anforderungen (Teil der Dimension „persönliche Maßstäbe“)
3. Der leistungsbedingte Selbstwert (geht hervor aus den Dimensionen
„Fehlersensibilität und Handlungszweifel“)
Den einzelnen Eigenschaften lässt sich isoliert gesehen pauschal ein positiver oder negativer Charakter zuordnen. Jedoch ist letztendlich immer die Konstellation der Facetten ausschlaggebend, wodurch grundsätzlich als positiv gewertete Facetten auch ins Negative umschlagen können.
i
Allgemein gilt, dass nicht nur die Definition des Begriffs Perfektionismus, sondern vor allem auch mögliche verschiedene Arten oder Kategorien viel diskutiert sind. Die folgenden Ausführungen stellen den Versuch dar, einen Mittelweg aus den verbreitetsten Ansätzen aufzustellen.
* In dieser Story nicht vertreten


In welchen Bereichen liegen hier perfektionistische Ansprüche vor?
4. Bereiche

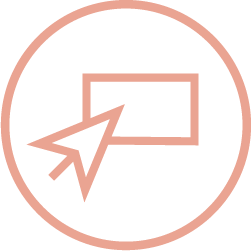
Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.
Liegst du falsch, versuche es erneut.
Eigentum
Arbeit
Hobbys / Freizeit
In diesem Fall lässt sich Perfektionismus im Kontext der Arbeit verordnen. Generell können einer oder mehrere Gebiete betroffen sein. Welche dies sind richtet sich danach, wo eigenes hohes Interesse besteht und wo großer Wert darauf gelegt wird, dass etwas erreicht und absolviert wird.
* In dieser Story nicht vertreten


In den Gebieten, in denen eine perfektionistische Person keine perfektionistischen Anforderungen erhebt, herrscht oft Benachteiligung. Das bedeutet, dass das Umfeld eines*r Perfektionist*in entweder direkt (perfektionistische Ansprüche) oder indirekt (keine perfektionistischen Ansprüche) durch den Perfektionismus involviert ist.


Was ist in dieser Geschichte die Ursache von Perfektionismus?
5. Ursachen

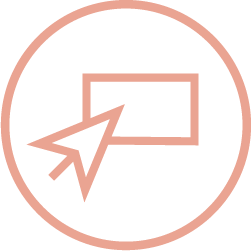
Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.
Liegst du falsch, versuche es erneut.
Vererbter Charakter
Mediale Ideale
Vorleben
Zurückzuführen ist Perfektionismus in diesem Fall auf eine zwischenmenschliche Ursache seitens der Beziehung zu anderen: das Vorleben der Lieblingslehrerin aus der vergangenen Schulzeit. Bei ihr wurde der Perfektionismus gesehen, bewundert und deswegen nachgeahmt. Ebenso spielen hier gesellschaftliche Einflüsse - die vermittelten Werte der Leistungsgesellschaft (nur viel und sehr gute Arbeit = beruflicher Erfolg) - sowie die natürlichen Einflüsse in Form von der Schnittmenge aus dem Zwischenmenschlichen und dem Gesellschaftlichen - die Selbsterziehung (Wunsch: der/die perfekte*r Angestellte*r sein) - eine Rolle.
Die generelle Existenz von Perfektionismus kann man auf die Rolle des Menschen in Gegenüberstellung mit dem Göttlichen zurückführen: das Aufsehen zu einem Leitbild, das aber utopisch und aussichtslos ist; eine Diskrepanz aus erreichen wollen, aber nicht erreichen können.
* In dieser Story nicht vertreten


6. Wie geht es weiter?
Geschichte anhören:
Geschichte lesen:
Wie gelähmt bewegst du dich auf deinen Arbeitsplatz zu. Auch dass dieser noch genauso ordentlich und sauber ist, wie du ihn vor dem Wochenende zurückgelassen hast, kann dich jetzt nicht aufheitern.
Die rationale Stimme in dir, die sagt „es ist doch nur eine Minute“, schafft es nicht, dein plagendes Bauchgefühl zu übertönen.
Du versuchst, die Situation hinter dir zu lassen und deine Empfindungen zu ignorieren, indem du schnell anfängst zu arbeiten - aber dein Kopf will einfach nicht funktionieren.
So sehr du auch versuchst, deine soeben am Laptop geöffneten Dateien durchzulesen - keine der Informationen bleibt bei dir hängen. Auch beim dritten, vierten, fünften Anlauf nicht.
„Du Schwächling, wo ist denn deine Konzentration hin?“, fragst du dich, findest aber keine Antwort.
Hektisch startest du einen sechsten Versuch, weil du auch ohne den Eintrag in deinem überfüllten Terminkalender weißt, dass gleich ein Meeting ansteht.
Danach wolltest du endlich mit deinen Vorgesetzten bezüglich Beförderung sprechen, weil du schon seit Jahren alles gibst und perfekt machst, aber trotzdem noch nicht die Möglichkeit bekommen hast, beruflich aufzusteigen.
Als es aber auch bei diesem Mal nicht funktioniert, scheint sich ein Schalter in dir umzulegen. Mit leerem Blick starrst du auf deinen Bildschirm.
Ohne eine weitere Handlung, eine weitere Bewegung siehst du, wie die Minuten vergehen, der Startzeitpunkt für das Meeting verstreicht, Menschen an dir vorbeilaufen - aber du bist wie erstarrt. Nichts scheint mehr real zu sein.
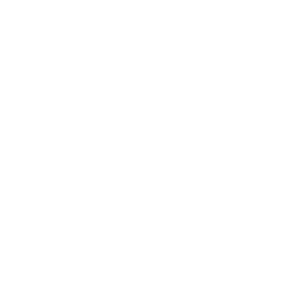
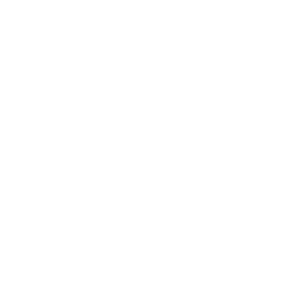
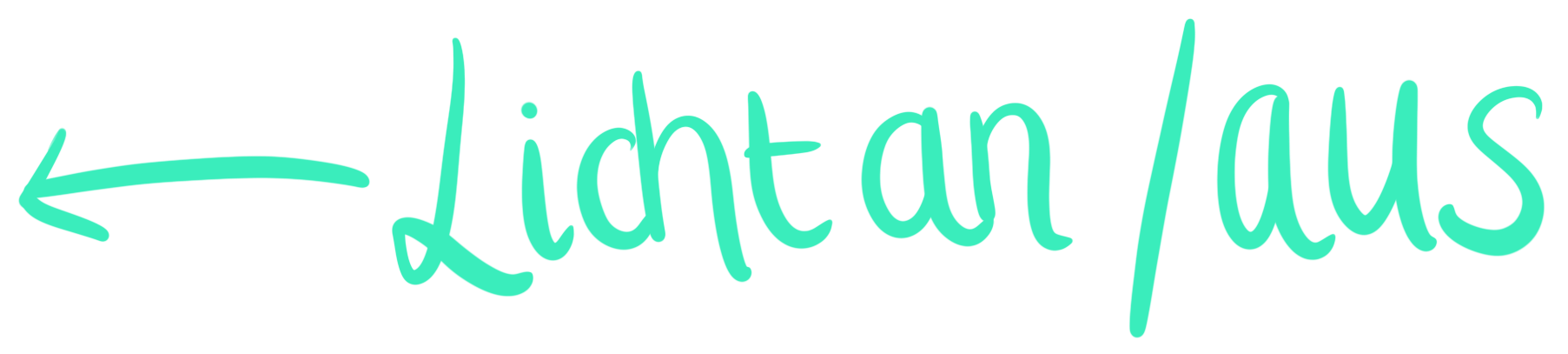
Was sind in dieser Story die Konsequenzen durch Perfektionismus?
7. Konsequenzen

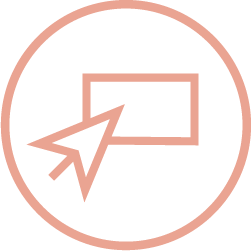
Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.
Stress
Burnout
Regelmäßigkeit
Die Antwort war teilweise richtig, weil nicht nur diese eine, sondern alle Optionen
und noch mehr Konsequenzen zutreffen: die Gesamtheit an vertretenen Folgen
findest du in der zweiten Grafik.
Generell gibt es eine große Bandbreite an möglichen Auswirkungen, zu denen
dysfunktionaler Perfektionismus führen kann, wovon die Mehrheit negativ ist.
Daneben besteht eine Auswahl an möglichen positiven Effekten. Diese muss man
jedoch in zweierlei Hinsicht im Verhältnis zu den negativen sehen: erstens, dass die
Auswahl an möglichen positiven Konsequenzen geringer ist und zweitens, dass die
Positiven oft von den Negativen überschattet werden, in dem das Vorkommen
positiver Empfindungen beispielsweise in deren Ausbleiben umschlagen kann.
Mit diesem Wissen kann aber auf das optimistische Ziel hingearbeitet werden: eine
Abwandlung vom dysfunktionalen zum funktionalen Perfektionismus - sich von den
beeinflussbaren Kosten lösen und die möglichen Nutzen als flexiblen Ansporn
einsetzen.


* In dieser Story nicht vertreten


Wie soll diese Situation entschärft werden?
8. Strategien
Wenn es um einen Eingriff in den Perfektionismus geht, ist wichtig zu wissen, dass
Perfektionismus nicht einfach an- und abgeschaltet werden kann. Er ist ein Teil des
Charakters - der aber in die eine oder andere Richtung aktiv geformt werden kann.
Dafür gibt es diverse Strategien, um den eigenen Perfektionismus zu hinterfragen, mehr vom Negativen ablassen und am Positiven festhalten zu können.
i
Diese Hilfestellungen sind lediglich als Unterstützung zu sehen. Bei ernsthaften Problemen gilt es in jedem Fall, ärztliche Hilfe aufzusuchen.
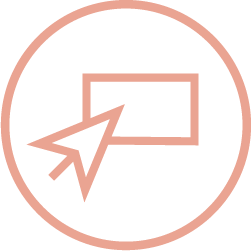
Wähle eine der Strategien aus, um sie einzusehen.
Du kannst dir alle anschauen und sie bei Bedarf selbst anwenden.
Kompromissaktionen im Alltag
Thema: Flexibilität
Art: Realistische Prüfung
Beschreibung:
Ein grundsätzliches dysfunktional perfektionistisches Verhängnis ist neben dem Ausmaß der Anforderungen auch deren Statik. Es wird eine Art Zwang empfunden: „Ich MUSS es schaffen!“
Dabei liegt eine Gegensätzlichkeit vor, weil zwar oft bereits die rationale Erkenntnis vorhanden ist, dass Anpassungsfähigkeit positiv wäre, es jedoch an der emotionalen Annahme dieser Tatsache scheitert.
Um das zu ändern, bietet sich der Weg an, konkrete Tätigkeiten im Alltag zu testen, die bewusst von den gewohnten perfektionistischen Anforderungen abweichen.
Ziele:
Grundlegend geht es darum, nach einer Einsicht zum Perfektionismus (dass die statische Art der Maßstäbe ungesund ist) etwas mit diesem neuen theoretischen Wissen anzufangen - nämlich, es in die Tätigkeiten und Mentalität übertragen zu können.
Speziell geht es darum, Abweichungen von der Norm verkraften zu können: gesund mit Fehlern, Misserfolgen oder sonstigen Imperfektionen zurecht zu kommen.
Ergebnis:
Plane für einen Tag ein, zu spät zu kommen. Du musst nicht übertreiben und das soll auch nicht deine neue Gewohnheit werden - dein perfektionistischer Anspruch der Pünktlichkeit kann weiter die Norm bleiben, aber ohne das verpflichtende Gefühl; ohne, dass zeitliche Abweichungen selbst-zerstörerisch sind.
Aufgabe:
Schritt 1:
Notiere dir Tätigkeiten, bei denen du perfektionistische Anforderungen hast.
Schritt 2:
Definiere dafür jeweils
A. die beste Extreme (die optimale Ausführung der Tätigkeit)
B. die schlechteste Extreme (die suboptimale Ausführung der Tätigkeit)
C. mehrere Mittelwerte zwischen diesen beiden Gegensätzen.
Schritt 3:
Wähle einen der Mittelwerte aus und nutze diesen als Erwartungshaltung bei der Realisierung der Tätigkeit.
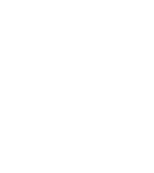
Vorlage herunterladen

Zeit-aus-dem-Fenster-Schmeißen
Thema: Zeit
Art: Gegenbild
Beschreibung:
Ein perfektionistischer Hang ist es, Zeit immer effizient und produktiv nutzen zu wollen. Aktivitäten, auf die diese Beschreibungen scheinbar nicht zutreffen, werden nicht oder mit Widerwillen angegangen. Außer Acht gelassen wird, dass Körper und Geist nicht langfristig unter Dauerbelastung funktionieren können. Ein Gegengewicht wird benötigt. Um sich von der Abneigung gegenüber Zeitverschwendung lösen zu können, stellt es eine Option dar, Dinge bewusst zu verlangsamen.
i
Diese Strategie ist nicht als Dauerzustand, sondern als bewusster Alltagsbruch zu verstehen.
Ziele:
Mittels dieser Übung kann man sich der Nachteile von Perfektionismus bezüglich seiner eigenen Beziehung zu Zeit bewusst werden, bei der man immer mit dem Kopf in der Zukunft ist und nicht aus dem Moment heraus lebt.
Durch diese Erkenntnis wird der Weg zur Stressreduktion geebnet.
Ergebnis:
Nehme dir beispielsweise deinen Arbeitsweg mit dem Auto an einem Tag vor, an dem keine wichtigen Meetings anstehen. Fahre ohne einen derart großen Puffer los und orientiere dich an gemütlichen Autofahrenden. Warst du trotzdem pünktlich? Falls nein: achte auf die Reaktionen der anderen: beschwert sich jemand, wenn du um 8:01 statt um 8:00 aus dem Aufzug trittst?
Aufgabe:
Schritt 1:
Wähle Aktivitäten aus, die du mit einer definierten Dauer ausführst.
Schritt 2:
Widme dich diesen Handlungen, indem du sie nicht in deinem gewohnten Tempo ausführst, sondern länger dauern lässt.
Schritt 3:
Vergleiche die achtsam investierte Zeit mit deiner bei der jeweiligen Handlung gewohnt eingesetzten Zeit. Der Differenzbetrag stellt sozusagen die Zeit dar, die du genutzt hast, deine Energie-Reserven aufzuladen und dir bei wichtigen To-Do’s als Mehr an Kraft zur Verfügung stehen.
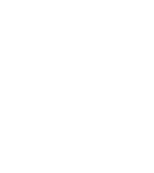
Vorlage herunterladen

Das war's!
Wie du gelernt hast, ist Perfektionismus ein sehr komplexes und vielschichtiges
Thema. Was kannst du zusammenfassend mitnehmen?
Dass es beim Thema Perfektionismus eine wichtige Rolle spielt, eine differenzierte
Ansicht zu haben: die Risiken der negativen Perfektionismus Potenziale sollten stets
ein zentrales Bewusstsein einnehmen, während die möglichen positiven Chancen gleichzeitig berücksichtigt und nicht überhöht werden - als eine Art Optimismus, vom
negativen zu einem positiven Perfektionismus gelangen zu können.





